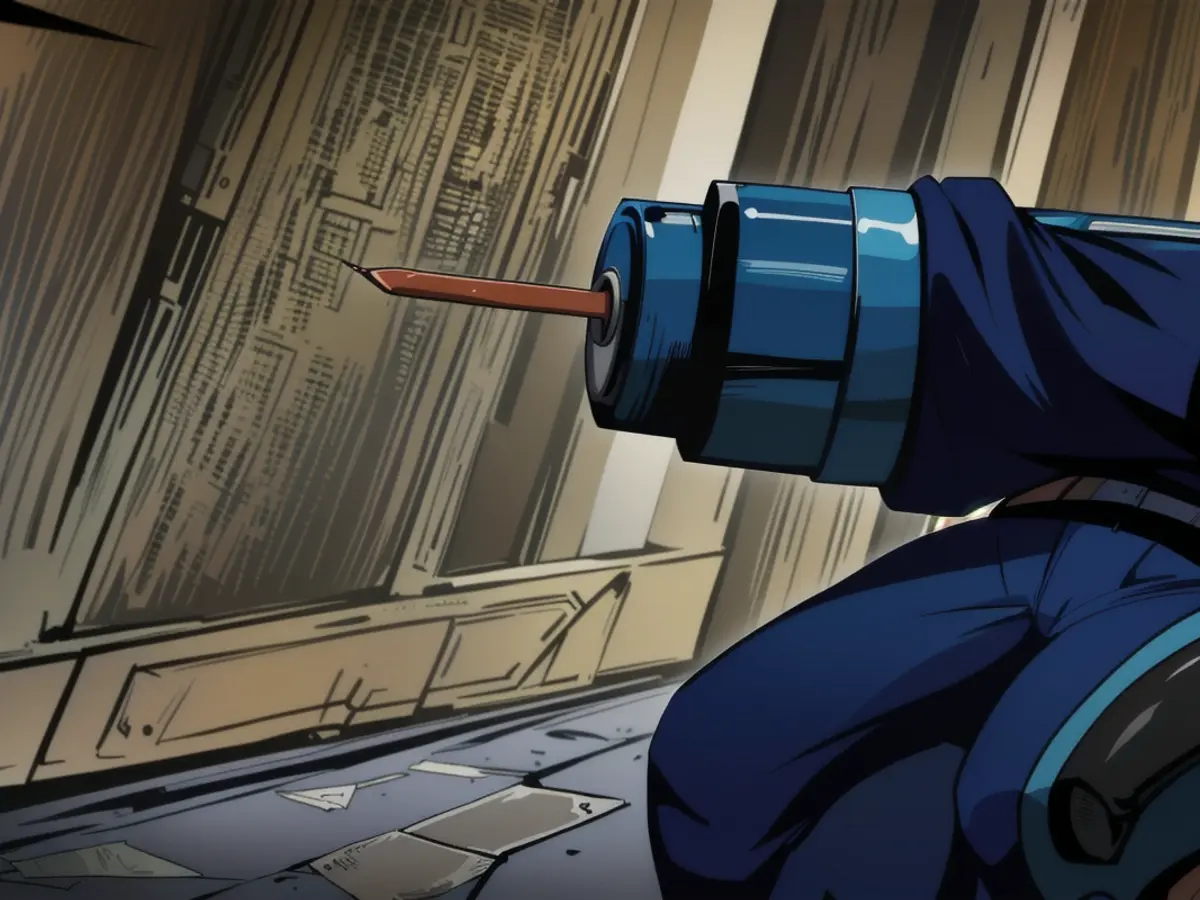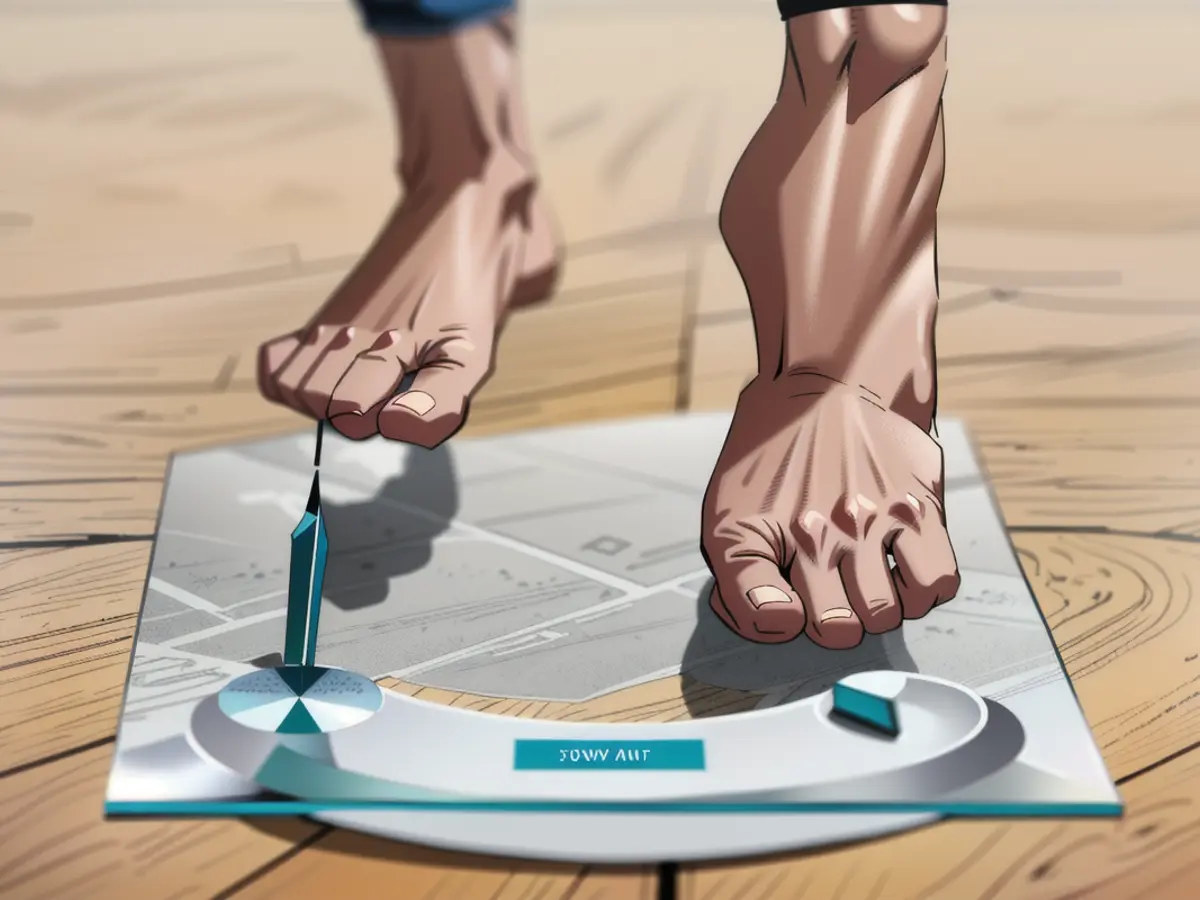Ich habe mich entschieden, nicht vor dem Kummer zu fliehen.
Einen Monat nach ihrer Beerdigung ging ich zu meiner Freundin zum Abendessen. Ich fühlte mich von den Gesprächen, die um mich herum stattfanden, losgelöst; mein Gehirn war von Traurigkeit vernebelt. Ich konnte nicht den Willen aufbringen, mich mit jemandem zu unterhalten.
Mein Blick fiel auf einen schönen Fotorahmen, der meine Freundin und ihre Mutter vor einem Rosenbusch in Eugene, Oregon, zeigte, wie sie sich innig umarmten.
Dieses Foto weckte Erinnerungen an das letzte Mal, als meine Mutter mich in Oregon besuchte. Sie teilte auf Facebook Bilder von allen Flughäfen zwischen Vermont und Eugene - ein aufgeschlagenes Buch auf ihrem Schoß in Salt Lake City, eine Kaffeetasse neben sich. "Drei Stunden und 17 Minuten, bis ich mein Mädchen sehe."
Als ich sie vom Flughafen abholte, eilte sie herbei, um mich zu begrüßen, und strahlte eine grenzenlose Aufregung aus. Wir verbrachten das Wochenende damit, am Willamette River zu laufen, überdachte Brücken in den Ausläufern der Cascades zu besichtigen und im Umkreis von 50 Meilen nach den köstlichsten Backwaren zu stöbern. Sie nahm an einem Halbmarathon teil. Sie war 64. Ich hatte das Gefühl, dass wir noch viele Meilen zusammen zurücklegen würden. Tausend weitere Abenteuer zu erleben.
Die Erinnerungen weckten eine Welle der Trauer, meine Oberschenkel zitterten, meine Augen tränten. Aus Angst, Aufmerksamkeit zu erregen, machte ich mich auf den Weg zur Toilette im Haus meines Freundes. Ich setzte mich auf die geschlossene Toilette und stopfte mir Toilettenpapier in die Augen, um zu versuchen, die Flut zu stoppen. Der Schmerz in meinem Herzen verstärkte sich. Ich beklagte mich innerlich über die Jahre, die Besuche und die Momente, die mit meiner Mutter verschwunden waren.
Das war nichts Neues. Früher hatte ich diese Momente genutzt, um meinen Kummer zu verbergen. Bei der Arbeit, im Fitnessstudio oder in der Schlange vor der Brauerei im Norden der Stadt verbarg ich meinen Kummer. Ich ertrug sie und ließ meine Tränen unter vier Augen heraus. Verstellung war das, worauf ich eingestellt war. Vorzugeben, dass es mir gut geht, auch wenn ich weit davon entfernt war.
Bei ihrer Beerdigung wurde ich mit dem Unbehagen konfrontiert, das die Menschen in Bezug auf meine Gefühle zu empfinden schienen. Als ob Trauer sie nervös machen würde. Ich hatte mich an ein gewisses Maß an emotionaler Einsamkeit gewöhnt und an die gesellschaftliche Erwartung, meinen Verlust schnell zu verarbeiten.
Ich hatte erlebt, wie Freundschaften schwanden und Kollegen meinen Arbeitsplatz nach jedem Besuch in Vermont mieden. Ich musste sogar das Scheitern einer Beziehung hinnehmen, weil sie nicht mit meinem Trauerprozess vereinbar war.
"Du bist nicht positiv genug", sagte mein damaliger Freund ein paar Monate nach der Diagnose eines seltenen Gebärmutterkrebses bei meiner Mutter. Ich war mir der Unausweichlichkeit ihres Ablebens bewusst. Sich positiv zu fühlen, schien absolut unerreichbar zu sein.
Meine Mutter stellte sich mutig ihrem Krebs, ihr Geist war ungezähmt. Sie ging jeden Tag auf den unbefestigten Straßen in der Nähe ihres Hauses spazieren, selbst als die Nebenwirkungen der Chemotherapie sie schwächten. Sie schrieb mir, dass ihre Freunde sie begleiteten und wie schön der Himmel über den sanften Hügeln aussah.
"Das ist es, was mich weitermachen lässt", sagte sie.
Laufen zu Ehren meiner Mutter
Um inmitten des Todes meiner Mutter Trost zu finden, beschloss ich, den 460 Meilen langen Abschnitt des Pacific Crest Trail quer durch Oregon in Angriff zu nehmen. Mein Ziel war es, jeden anderen Menschen zu übertreffen, der dieses Kunststück versuchte. Meine Mutter hatte meine Leidenschaft für den Laufsport geweckt, und ihr erster Marathon hatte mein Interesse geweckt - es war nur natürlich, in ihrem Andenken zu laufen.
Als ich dann mit dem Training begann, kam ich nicht umhin, mich zu fragen, ob es klug war, einen so anspruchsvollen Lauf zu versuchen, während ich von Trauer umhüllt war.
Bei einer meiner ersten Trainingseinheiten kämpfte ich mich durch die üblichen Vorbereitungen. Das Strecken meiner Finger fühlte sich an wie das Manövrieren durch Teer. Ich stapfte zögernd und zweifelnd zu den bewaldeten Hügeln hinter meinem Haus. Meine Beine waren schwer wie Lehm, und ich dachte über die verwirrende Entscheidung nach, die ich getroffen hatte.
Sobald ich mit den Sohlen meiner Laufschuhe die gepolsterte Erde berührte, atmete ich tief ein. Mein Atem füllte mich wie ein Gebirgsbach, der endlich aus dem Damm, den mein Kummer gebildet hatte, herausströmte. Das war es, was ich gewohnt war: den Kummer in mich aufzunehmen und ihn dann loszulassen. Den Tränen nahe, eilte ich ins Badezimmer im Haus meines Freundes, da ich meinen Gefühlszustand nicht vor einem Publikum offenbaren wollte.
Also beschloss ich, meinen Kummer in mir zu tragen. So zu tun, als ginge es mir gut, obwohl ich alles andere als das war, wurde zur Gewohnheit, zur Lebensweise. Wenn man mich fragte, wie es mir ging, antwortete ich mit der gleichen leeren Floskel wie alle anderen: "gut". Ich lernte, meinen Kummer zu verbergen und innerlich zu leiden, während ich mit der Schuld rang, meinen Kummer zurückgehalten zu haben. Jetzt war das ein Teil meiner Identität.
Aber der Lauf auf dem Pacific Crest Trail würde etwas anderes sein. Ich konnte keine Maske tragen, während ich 460 Meilen lief, denn es könnte ja jemand dabei sein, der mich beobachtet, wenn ich über eine stolpere. Die Trauer war die Wahrheit, und ich würde durch sie hindurchlaufen und zulassen, dass mein Herz aufbricht. Immerhin hat sie es getan.
Die sanfte Erde stützte meine Schritte, als ich weiterlief. Der Wind rührte an den Nadeln der nahen Kiefern und umgab mich. Ich erinnerte mich daran, wie ich meine Mutter auf diesem Weg geführt hatte, und spürte, wie eine brennende Träne meine Wange hinunterlief und auf den Boden sank. Die heftige Sehnsucht nach ihr begleitete mich auf meinem Weg.
Während des ersten Marathons, an dem ich mit meiner Mutter teilgenommen hatte, war ich in einem zügigen Tempo losgelaufen und nach der Hälfte der Strecke müde geworden und hatte das Gefühl, nicht mehr weiterlaufen zu können. An der 14-Kilometer-Marke sah ich sie an mir vorbeiziehen - und ich war verblüfft, dass ihr Schritt so gleichmäßig und stark war.
Ich rief ihr zu: "Mama!", als wäre ich ein fünfjähriges Kind, das nach seiner Mutter ruft. Aber die Menge der Läufer war zu dicht, als dass sie mich hätte hören können.
Ich rief erneut: "Mama!"
Ich habe in diesem Moment nicht versucht, meine Gefühle zu verbergen. Nur wenige Menschen tun das, wenn sie einen Marathon laufen, oder eine längere Strecke. Wenn Sie am Rande eines Marathons stehen, werden Sie Zeuge von unverfälschten menschlichen Emotionen, die sich zeigen.
Eines der Dinge, die ich am meisten am Laufen liebe, ist dieses Phänomen.
Offenbarende Trauer beim Laufen
Bei einem 100-Meilen-Lauf ist es fast selbstverständlich, dass man einen Tiefpunkt erlebt. Fast niemand erreicht die Ziellinie, ohne mit einer harten Realität konfrontiert zu werden: quälende Selbstzweifel, zerstörte Muskeln, ein mürrisches Verdauungssystem, demütigende Unsicherheit.
In diesen Momenten flüchten wir uns nicht in ein Badezimmer, um unsere Gefühle zu verbergen. Stattdessen stellen wir uns diesen Herausforderungen in der Gesellschaft unserer Mitläufer, unserer Freunde, der Helfer und der Zuschauer.
Als meine Energie bei Kilometer 40 meines ersten 100-Meilen-Laufs versiegte, teilte ich den Mitgliedern meines Teams mit: "Ich habe gerade eine schwierige Zeit", und sie ließen sich von meiner misslichen Lage nicht beeindrucken. Sie halfen mir, mich in einen Campingstuhl zu setzen, brachten mir Quesadillas und warteten an meiner Seite. Sie boten mir einen sicheren Raum, um mein Tief zu überwinden.
Wenn wir an der Startlinie eines Marathons oder eines 100-Meilen-Laufs stehen, erkennen wir die Verletzlichkeit an, die mit diesem Ereignis verbunden ist. Wir wissen, dass wir eine schwierige Phase erleben könnten. Wir wissen, dass wir zu einem lebenden Aushängeschild für unsere schwierigsten Momente werden könnten. Und wir marschieren ohne zu zögern auf dieses Szenario zu. Wir versprechen den Menschen neben uns, dass wir sie bei der Bewältigung ihrer eigenen Tiefs unterstützen und ihnen nicht aus dem Weg gehen werden.
Es gibt nur wenige Orte, an denen eine solche emotionale Ehrlichkeit willkommen ist - und die einen sicheren Ort bieten, an dem sie sich entfalten kann.
Gesellschaftlicher Druck, nicht zu trauern
Mir wurden fünf Arbeitstage Trauerurlaub gewährt. In dieser Gesellschaft gibt es eine Grenze für die Zeit, in der ich ein trauriges Mädchen sein darf, und zwar in Anwesenheit anderer als meiner engsten Familienmitglieder und Freunde. Ich stehe unter dem Druck, aus den Tiefen der Trauerstadt in die Straße des Guten zu wechseln. Trotz meiner Versuche, dies zu tun, bin ich noch nicht so weit.
Auf dem Weg war ich frei, meine Gefühle zu erleben. Als ich mich in den Wald wagte, war ich wie eine Schlange, die ihre frühere Hülle abwirft und einen sensiblen Teil von sich preisgibt. Ich konnte meine Schutzmechanismen ablegen und meine stärksten Gefühle zum Vorschein bringen.
Anfangs hatte ich befürchtet, dass das Pacific Crest Trail Race zu anstrengend sein würde. Mit fortschreitendem Training wurde mir jedoch klar, dass das Laufen für mich der ideale Ort war, um meine Trauer zu verarbeiten. Ich fand Zuflucht in den Kilometern, die mir erlaubten, meine Verehrung für meine Mutter und meine Trauer über ihr vorzeitiges Ableben zum Ausdruck zu bringen. Das Laufen bot mir etwas, das leider nur schwer zu finden ist: einen Ort, an dem ich nichts verbergen musste, an dem ich die Weite des Geländes unter meinen Füßen und den weiten blauen Himmel über mir offen zum Ausdruck bringen konnte.
Lesen Sie auch:
- Die USA bilden eine Militärkoalition zur Bekämpfung von Houthi-Angriffen auf Schiffe im Roten Meer
- Bauern protestieren gegen „Ampel“-Sparplan – Özdemir: „Ich werde kämpfen“
- Auf dem Weg nach Wembley: Das Remisglück des FC Bayern München
- Kein Weihnachtsfrieden für die britische Königsfamilie
Quelle: edition.cnn.com